Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. IBC-Module überzeugen bei schwacher Lichtintensität mit stabiler Leistung
2. IBC-Module erfüllen ästhetische und regulatorische Anforderungen im urbanen Umfeld
3. Zuverlässiger Betrieb von IBC-Modulen auf heißen Dächern und bei starker Reflexion
4. IBC-Module als Lösung für langfristig stabile Ertragsprojekte
5. IBC-Module sind nicht die erste Wahl bei bestimmten baulichen oder budgetären Einschränkungen
Einleitung
In den letzten Jahren hat der Photovoltaikmarkt in Deutschland deutlich an Dynamik gewonnen. Wohngebäude, Gewerbeimmobilien und öffentliche Projekte konkurrieren zunehmend, während zugleich der Investitionsdruck durch steigende Kosten wächst. Projektentwickler müssen nicht nur zwischen Strompreisen, Fördermechanismen und Zuschüssen abwägen, sondern sich auch mit baulichen Einschränkungen der Dächer, städtebaulichen Vorgaben zur Gebäudeästhetik sowie regionalen Unterschieden bei der Sonneneinstrahlung auseinandersetzen.
Anstelle reiner Kennzahlenvergleiche entscheidet heute vor allem die strukturelle und anwendungsspezifische Eignung eines Moduls über dessen Wert. IBC-Module rücken dabei verstärkt in den Fokus – dank ihres gitternetzfreien Designs, ihrer starken Schwachlichtleistung und ihrer stabilen Temperaturkontrolle. Doch sind sie für jedes Projekt geeignet? Lohnt sich der höhere Anschaffungspreis? Und sind die Projektbedingungen ausreichend, um die strukturellen Vorteile dieser Technologie voll auszuschöpfen?
1. IBC-Module überzeugen bei schwacher Lichtintensität mit stabiler Leistung
In Deutschland – insbesondere in Mittel- und Norddeutschland sowie in Gebirgsregionen – sind die täglichen Sonnenstunden im Winter oft stark begrenzt. In manchen Gegenden liegt die effektive jährliche Sonneneinstrahlung unter 1.100 Stunden. Hinzu kommt, dass zahlreiche Dächer durch Ausrichtung, Verschattung oder Umgebungsfaktoren beeinträchtigt sind, sodass auch an klaren Tagen häufig nur geringe Strahlungsintensität oder ein ungünstiger Einstrahlungswinkel vorliegt.
Solche Bedingungen mit geringer Lichtintensität stellen einen entscheidenden Faktor für die tatsächliche Systemleistung dar. In diesen Fällen zählt nicht mehr die nominelle Spitzenleistung, sondern vielmehr, wie effizient das Modul diffuses und schwaches Licht aufnehmen und nutzen kann.
Zwei zentrale Merkmale verleihen IBC-Modulen in lichtschwachen Umgebungen eine höhere Stabilität:
- IBC-Module verfügen über ein rückseitiges Kontakt-Design, ohne metallische Frontgitter, was die Lichtausbeute bei schwacher Einstrahlung deutlich verbessert.
- Die internen Strompfade in IBC-Modulen sind kürzer, was Serienverluste beim Anlauf bei niedriger Spannung reduziert und die Energieausbeute in den Morgen- und Abendstunden steigert.
Ein entsprechender Praxistest belegt dies: Ein 430 W IBC-Vollschwarz-Modul wurde unter identischen Bedingungen mit einem bifazialen Glas-Glas-Modul derselben Leistungsklasse verglichen. Bei bewölktem Himmel und geringer Einstrahlung erreichte das IBC-Modul eine Momentanleistung von 117 W, während das Vergleichsmodul lediglich 100 W lieferte – ein Plus von rund 17 %. In der kumulierten Energieerzeugung über einen Zeitraum von zwei Wochen lag das IBC-Modul insgesamt fast 20 % über dem Vergleichsmodul.
Weitere Testergebnisse sind im offiziellen Blogbeitrag von Maysun Solar unter dem Titel „IBC-Solarmodule im Vergleich zu bifazialen Glas-Glas-Modulen – Schwachlicht-Leistung im Test“ veröffentlicht.
Diese Unterschiede zeigen deutlich: Bei Projekten mit hohem Anteil an lichtarmen Zeiträumen und eingeschränkten Einstrahlungsbedingungen bieten IBC-Module eine stabilere Grundleistung und tragen strukturell zur besseren Gesamtperformance des Systems bei.
2. IBC-Module erfüllen ästhetische und regulatorische Anforderungen im urbanen Umfeld
Bei Dach-Photovoltaikprojekten in Deutschland beeinflusst die Modulstruktur nicht nur das äußere Erscheinungsbild und die Genehmigungsprüfung, sondern ist auch ein technischer Parameter, der im Rahmen der städtebaulichen Gestaltungsvorgaben berücksichtigt werden muss. Insbesondere in Altstädten, gemischt genutzten Stadtgebieten und denkmalgeschützten Bereichen stehen PV-Projekte vor der Herausforderung begrenzter Dachflächen sowie baulicher Prüfungen und nachbarschaftlicher Bewertungen. Farbgleichmäßigkeit, sichtbare Strukturen und Reflexionseigenschaften der Module sind zu entscheidenden Faktoren für die Realisierbarkeit geworden. Klassische silberne Module weisen bei starker Spiegelung, auffälligen Metalllinien und deutlichen Farbunterschieden klare Nachteile auf und sind für solche Projekte oft ungeeignet.

Die rückseitige Kontaktstruktur von IBC-Modulen verbessert das sichtbare Erscheinungsbild auf dem Dach:
- Keine metallischen Frontgitter, wodurch Lichtbrechung und störende Strukturen bei wechselnden Einstrahlungswinkeln vermieden werden.
- Einheitliches Design mit schwarzem Glas, schwarzem Rahmen und schwarzer Rückseitenfolie, das eine höhere visuelle Einheitlichkeit und reduzierte Reflexion ermöglicht.
- Lötfreie Elektrodentechnologie mit einer Oberflächenreflexion von nur 1,7 %, die Blendeffekte effektiv unterdrückt und die Umgebung sowie das Sichtfeld der Nachbarn weniger stört.
Diese Vorteile verbessern die visuelle Integration in gebäudeintegrierte PV-Projekte (BIPV) und erleichtern die Genehmigung.
Auch die Regelungen werden zunehmend strenger. In den Prüfanforderungen für Wohngebäude in Baden-Württemberg heißt es: „Photovoltaikmodule dürfen keine spiegelnden Oberflächen aufweisen und keine farbigen oder glänzenden Rahmen verwenden.“ Die Denkmalschutzrichtlinien Berlins empfehlen ebenfalls den Einsatz von „dunklen, matten Modulen“. In zahlreichen BIPV-Projekten sind Eigenschaften wie ein vollschwarzes Erscheinungsbild oder blendfreie Ausführung bereits zu klar definierten technischen Anforderungen geworden.
Daher bieten vollschwarze IBC-Module mit ihren strukturellen Eigenschaften eine Möglichkeit, Genehmigungshürden zu reduzieren und Planungsprobleme zu vermeiden – eine umsetzbare Option für urbane Photovoltaikprojekte.
3. Zuverlässiger Betrieb von IBC-Modulen auf heißen Dächern und bei starker Reflexion
Photovoltaikmodule sind im Realbetrieb häufig komplexen Dachbedingungen ausgesetzt: anhaltende Hitze, starke Lichtreflexion und begrenzte Tragfähigkeit sind typische Herausforderungen bei Industriehallen, Metalldächern oder städtischen Flachdachprojekten. Die Fähigkeit eines Moduls, unter solchen Bedingungen eine stabile Stromerzeugung und strukturelle Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, ist zu einem entscheidenden Kriterium für die Bewertung seiner Eignung geworden.
3.1 Warum können IBC-Module auf heißen Dächern stabil Strom erzeugen?
In zahlreichen Industrie- und Agrardachprojekten in Deutschland sind Metalldächer weit verbreitet. Diese absorbieren im Sommer besonders viel Wärme, wodurch Oberflächentemperaturen von über 65 °C keine Seltenheit sind – in Extremfällen können sie sogar 80 °C erreichen. Die Hitze wird direkt auf die Module übertragen, was zu deutlich höheren Betriebstemperaturen im Vergleich zu den Standard-Testbedingungen (25 °C) führt und einen Leistungsverlust sowie eine Effizienzminderung nach sich zieht.
Ein entscheidender Kennwert zur Beurteilung dieser Temperaturabhängigkeit ist der Temperaturkoeffizient. Bei den gängigen Technologien liegt dieser bei:
- PERC-Modulen: ca. –0,35 %/°C
- IBC-Modulen: ca. –0,29 %/°C
Wenn die Modultemperatur von 25 °C auf 65 °C ansteigt, sinkt die Leistung von PERC-Modulen um rund 14 %, bei IBC-Modulen lediglich um 11,6 % – ein Unterschied von 3,4 Prozentpunkten. Je größer die installierte Leistung und je länger die Temperaturbelastung anhält, desto stärker wirkt sich dieser Unterschied auf den Gesamtertrag und die Wirtschaftlichkeit des Systems aus.
Dank ihres rückseitigen Kontaktaufbaus und verkürzter Strompfade weisen IBC-Module eine geringere Leitungsverluste und Wärmeakkumulation auf. Diese strukturellen Vorteile helfen dabei, Leistungsschwankungen unter Hitze zu minimieren. Selbst auf heißen Metalldächern von Lagerhallen, Logistikzentren oder Agrarbetrieben liefern IBC-Module dadurch konstant stabile Erträge – ein bedeutender Mehrwert für Projekte mit hohen thermischen Anforderungen.
3.2 Wie reduzieren IBC-Module das Hotspot-Risiko bei starker Reflexion?
In deutschen Projekten mit Agrardächern, Industriehallen oder Metalldächern stehen PV-Module oft vor zwei gleichzeitigen Herausforderungen:
- Erstens: partielle Verschattungen durch Lüftungsrohre oder Trägerstrukturen
- Zweitens: ungleichmäßige Einstrahlung durch Reflexionen der Metalloberflächen
Solche inhomogenen Lichtverhältnisse führen leicht zu Stromungleichgewichten, die sogenannte Hotspot-Effekte verursachen können. Diese führen im harmloseren Fall zu einer beschleunigten Alterung der Verkapselung – im schlimmsten Fall jedoch zu Leistungsabfall oder sogar thermischen Schäden an den Modulen.
Die Modulstruktur spielt in solchen Umgebungen eine entscheidende Rolle. IBC-Module mit rückseitiger Kontaktierung und metallfreier Vorderseite ermöglichen eine gleichmäßigere Lichtaufnahme, da Reflexions- und Verschattungsränder weniger starke Stromkonzentrationen erzeugen. Die kürzeren internen Strompfade innerhalb jeder Zelle sowie die geringe Stromdifferenz zwischen Zellsträngen helfen zusätzlich, Wärmestau zu vermeiden und das Risiko von Hotspots deutlich zu senken.

Ein Vergleichstest des Fraunhofer ISE zeigt: Bei 30 % teilweiser Verschattung stieg die Hotspot-Temperatur bei PERC-Modulen auf 32 °C, während ein gleich großes IBC-Modul lediglich 18 °C erreichte – eine Differenz von 14 °C, die die überlegene Wärmeverteilung und Hotspot-Resistenz von IBC-Modulen unterstreicht.
Darüber hinaus verfügen IBC-Module über eine erhöhte Hitzebeständigkeit und mechanische Belastbarkeit, was die Alterung der Verkapselung sowie die Vergilbung des EVA-Materials verzögert. Damit bleiben sie auch bei intensiver Reflexion und stark schwankenden Temperaturen – etwa auf Trocknungsdächern, Metalldächern oder urbanen Flachdächern mit vielen Störfaktoren – über lange Zeit hinweg stabil und leistungsfähig.
3.3 Eignen sich IBC-Module für leichte Dachkonstruktionen und dauerhaft hohe Temperaturen?
In vielen städtischen Projekten in Deutschland – etwa auf alten Industriehallen, leichten Trapezblechdächern oder Wohngebäudeplattformen – bestehen häufig strukturelle Einschränkungen hinsichtlich der Dachlast. Aufgrund dicker Dämmung und unzureichender Belüftung kommt es im Sommer leicht zur Hitzestauung, wodurch die Module dauerhaft bei Temperaturen von 60–75 °C betrieben werden. Dies erhöht das Risiko von Verkapselungsalterung und thermisch bedingten Ausfällen.
Moderne IBC-Module setzen auf ein leichtes Monoglas-Design mit hochfestem Sicherheitsglas und leistungsfähigen Verkapselungsmaterialien. Das Modulgewicht pro Quadratmeter liegt bei nur ca. 10,45 kg/m² – deutlich leichter als bei Glas-Glas-Modulen – und reduziert somit die Belastung auf das Dach.
Beim 85 °C / 85 % r.F.-Test des TÜV Rheinland zeigten führende IBC-Module nach 1.000 Stunden eine Leistungsminderung von weniger als 1,9 %, was ihre hohe Zuverlässigkeit unter feucht-heißen Bedingungen belegt.
Durch ihre rückseitige Kontaktstruktur benötigen IBC-Module keine Frontkontakte oder sichtbare Lötstellen, was die Gefahr von Mikrorissen infolge thermischer Ausdehnung verringert. In mehreren städtischen Projekten mit über 3 Jahren Laufzeit wurden keine Anzeichen für Lötstellenversagen festgestellt – ein klares Indiz für ihre Stabilität unter thermischer und mechanischer Belastung.
Für Dächer mit hoher Wärmelast und begrenzter Tragfähigkeit stellen leichte IBC-Module somit eine sinnvolle Lösung dar, die Belastung, Sicherheit und Langlebigkeit optimal in Einklang bringt.
4. IBC-Module als Lösung für langfristig stabile Ertragsprojekte
Für Projekte mit langfristigem Betrieb und Asset-orientierten Investitionszielen bieten IBC-Module durch ihre strukturellen Eigenschaften besondere Vorteile in Bezug auf Ertragssicherheit, geringe Degradation und Systemstabilität.
4.1 Warum eignen sich IBC-Module besonders für ertragsorientierte Langzeitprojekte?
Bei mittel- bis langfristig gehaltenen Photovoltaikanlagen ist der Anschaffungspreis nur ein Teil der Entscheidung. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob das System über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren stabile Erträge, geringen Wartungsaufwand und kalkulierbare Renditen erzielt. Gerade in Deutschland, wo firmeneigene Dachanlagen, Stromabnahmeverträge (PPA) und öffentliche PV-Initiativen zunehmen, werden Solarsysteme zunehmend als Bestandteil der Vermögensplanung betrachtet.
IBC-Module bieten mehrere strukturelle Vorteile zur Sicherung langfristiger Erträge:
- Die Anfangsdegradation liegt unter 1,5 %, der jährliche Leistungsverlust danach bei maximal 0,4 %. Nach 25 Jahren bleiben somit rund 89 % der Nennleistung erhalten – im Vergleich zu etwa 82 % bei typischen PERC-Modulen.
- Rückseitenkontaktierung ohne Frontlötstellen und Hauptstromschienen reduziert die Lötfläche um ca. 80 % und erhöht die Lichtaufnahmefläche um 2,5 %. Das minimiert thermische Ermüdung und Kontaktalterung, verbessert die Betriebssicherheit und verringert ungeplante Wartung.
- Lötfreie Laserverfahren senken Reflektionen auf nur 1,7 %, wodurch Blendwirkung minimiert und zugleich die Herstellungskosten kontrolliert werden – ein Kosten-Nutzen-Vorteil gegenüber TOPCon-Modulen.
- Keine metallischen Frontkontakte erweitern das Lichtspektrum auf 300–1200 nm und verbessern die Schwachlichtleistung, etwa bei Sonnenauf- und -untergang.
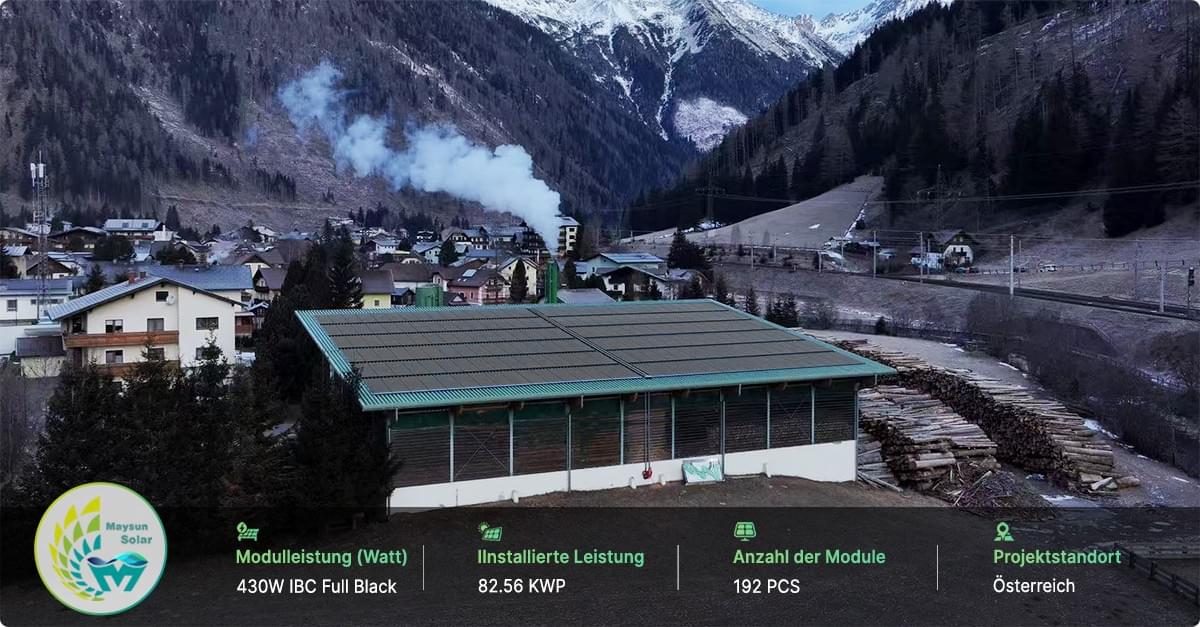
Diese Eigenschaften machen IBC-Module ideal für Projekte mit hoher Sensibilität gegenüber Stabilität und LCOE – etwa firmeneigene Anlagen, öffentliche Gebäude oder PPA-Vorhaben. In Finanzierungsmodellen ermöglicht die zuverlässige Langzeitleistung bessere Planbarkeit von Cashflow und Kapitalstruktur – ein zentraler Vorteil für renditeorientierte Investitionen.
4.2 Welchen Einfluss hat die IBC-Modulstruktur auf die Erträge über den Systemlebenszyklus hinweg?
Bei einer Laufzeit von bis zu 25 Jahren hängt der wirtschaftliche Erfolg einer PV-Anlage nicht nur von der Anfangseffizienz ab, sondern maßgeblich davon, wie gut die Modulstruktur langfristig Leistungsdegradation, Fehlerrisiken und Wartungsaufwand kontrollieren kann.
Im Vergleich zu konventionellen Modulen zeigen IBC-Module ihre strukturellen Vorteile in zwei entscheidenden Phasen: in der frühen Betriebszeit durch besonders stabile Leistung und im späteren Lebenszyklus durch langsame Alterung.
In den ersten 10 Betriebsjahren gewährleisten IBC-Module durch ihre geringe Anfangsdegradation und starke Schwachlichtperformance einen hohen Energieertrag. Die rückseitige Kontaktierung mit verkürzten Stromwegen und reduzierten Lötstellen minimiert das Risiko temperaturbedingter Kontaktfehler und verlängert die Phase effizienter Stromproduktion.
In der zweiten Hälfte des Lebenszyklus – von Jahr 15 bis 25 – wirkt sich die Struktur nochmals deutlich auf den Ertrag aus: Weniger Lötstellen auf der Rückseite reduzieren Mikrorissbildung, fördern die elektrische Stabilität und tragen zur konstanten Leistungsabgabe des Gesamtsystems bei.
Ein Beispiel: Bei einer 100 kWp großen, eigengenutzten Dachanlage in Deutschland behalten IBC-Module bis zum 25. Jahr 89 % ihrer Leistung, was etwa 9 % mehr Gesamtenergieertrag im Vergleich zu PERC-Modulen bedeutet. Gleichzeitig sinken die Betriebskosten um 15–20 %, da größere Austausch- oder Reparaturmaßnahmen entfallen. Insgesamt ergibt sich ein um 4–6 % niedrigerer LCOE, was PPA- oder Leasingprojekte finanziell planbarer und risikoärmer macht.

4.3 Wie reduzieren IBC-Module langfristige Systemrisiken und Unsicherheiten?
Im langjährigen Betrieb von Photovoltaikanlagen resultiert die Unsicherheit der Erträge im Wesentlichen aus zwei zentralen Risikofaktoren: ungleiche Leistungsdegradation und plötzliche Ausfälle infolge struktureller Alterung.
Strukturstabilität reduziert Degradationsschwankungen
Dank rückseitiger Kontaktierung ohne Frontgitter und Lötstellen minimieren IBC-Module thermische Spannungen, Feuchtigkeitseintritt und Lötstellenalterung – allesamt Ursachen für ungleichmäßige Leistungsverluste. Dadurch bleibt die Leistungsabgabe zwischen den Modulen über 25 Jahre hinweg konsistenter, was die Vorhersagbarkeit des Gesamtertrags deutlich erhöht.
Fehlertoleranz sichert den durchgängigen Betrieb
Auf komplexen Dächern oder bei teilweiser Verschattung profitieren IBC-Module von kurzen Stromwegen und geringer Stromkonzentration. Selbst bei lokalen Störungen bleibt der Strang stabil, und Einzelfehler breiten sich nicht auf das Gesamtsystem aus – ungeplante Wartungseinsätze werden so seltener erforderlich.
Risikoreduktion verbessert die finanzielle Planbarkeit
In PPA- und Leasingmodellen, die auf langfristig stabilen Cashflows beruhen, sorgt die strukturelle Ausgeglichenheit von IBC-Modulen für eine geringere Varianz über die gesamte Lebensdauer hinweg. Besonders in den späteren Betriebsjahren wird die Leistungsstabilität zwischen den Modulen zum entscheidenden Faktor für Asset-Bewertungen und Risikoparameter – was Finanzierungszugang und Konditionen positiv beeinflusst.
5. IBC-Module sind nicht die erste Wahl bei bestimmten baulichen oder budgetären Einschränkungen
Trotz ihrer strukturellen Vorteile in Bezug auf Effizienz und Stabilität sind IBC-Module nicht für jedes Photovoltaikprojekt die optimale Lösung – insbesondere wegen ihrer höheren Anschaffungskosten und der sensiblen Anforderungen an Installationsgenauigkeit.
- Bei kurzen Projektlaufzeiten, begrenztem Budget oder komplexen Installationsbedingungen (z. B. temporäre Energieversorgung oder stark kostenoptimierte Eigenverbrauchssysteme) lässt sich die höhere Anfangsinvestition schwer amortisieren. In solchen Fällen kann der spezifische Stromgestehungspreis (LCOE) steigen.
- Auf unregelmäßigen Dächern mit Verschattungen oder ungenauer Modulplatzierung stellen IBC-Module durch ihre hohen Anforderungen an Stromausgleich und Stringkonsistenz ein Risiko für lokale Leistungsverluste und Systeminstabilität dar.
- In Projekten ohne professionelle Installation oder langfristige Wartung, wie z. B. kleinteilige gewerbliche Verteilungen oder externe EPC-Aufträge, kann die hinterseitige Kontaktstruktur und hohe Leistungsdichte von IBC-Modulen die Wartung und den Austausch erschweren.
In Szenarien mit solchen Einschränkungen bieten TOPCon- oder hocheffiziente PERC-Module aufgrund ihrer besseren Anpassungsfähigkeit und Installationsfehlertoleranz oft ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Kostenkontrolle und Systemstabilität.
Letztlich steht bei der Modulwahl im Vordergrund, die baulichen Rahmenbedingungen, technische Umsetzbarkeit und langfristigen Projektziele realistisch zu bewerten. IBC-Module bieten in vielen Anwendungskontexten Vorteile – doch nur mit klarer Kenntnis ihrer Grenzen lässt sich eine technisch wie wirtschaftlich tragfähige Systemkonfiguration entwickeln.
Maysun Solar ist seit 2008 auf dem europäischen Markt tätig und hat über 1,1 GW an Hochleistungs-Photovoltaikmodulen ausgeliefert. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Unterstützung von der Modulauswahl über die Projektumsetzung bis hin zum Betrieb. Die IBC Module zeichnen sich durch hohe Ertragsstabilität und hervorragende bauliche Integration aus und eignen sich besonders für Stadtdächer, BIPV-Anwendungen sowie heiße oder teilverschattete Umgebungen. Ergänzend dazu bieten TOPCon Module und HJT Module hohe Effizienz und Witterungsbeständigkeit für unterschiedliche Projektanforderungen. Für Privatkunden stehen Balkonkraftwerke zur Verfügung, die einen einfachen Zugang zu erneuerbaren Energien ermöglichen.
Quellenverzeichnis
Fraunhofer ISE. (2023). Thermal Behaviour of Solar Modules under Partial Shading Conditions. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems. https://www.ise.fraunhofer.de
TÜV Rheinland. (2022). Long-Term Damp Heat Test Report for PV Modules (85°C/85% RH – 1000h). TÜV Rheinland Group. https://www.tuv.com
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg. (2023). Hinweise zur Genehmigungspflicht von Photovoltaikanlagen auf Wohngebäuden. https://mlw.baden-wuerttemberg.de
Landesdenkmalamt Berlin. (2023). Photovoltaik auf Baudenkmalen – Empfehlungen für Planung und Genehmigung. https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/
Maysun Solar. (2024). IBC-Solarmodule im Vergleich zu bifazialen Glas-Glas-Modulen – Schwachlicht-Leistung im Test. Maysun Solar Blog. https://www.maysunsolar.de/blog/ibc-bifacial-modul-schwachlicht-test
Empfohlene Lektüre

